Max sein SciFi-Blog (2024-10-13 bis 2025-05-17)
Übersicht
Hier finden sich die folgenden Rezensionen (ein Klick auf das entsprechende Cover führt direkt zum gewünschten Buch):
Hinweis am Rande:
Meine Bewertungsskala eicht sich an Werken wie The left hand of darkness von LeGuin, Es ist nicht leicht ein Gott zu sein von den Strugatzkis oder Eden von Lem. Die bekommen von mir volle fünf Sterne.
Der erste Satz (und der zweite)
„Geräusche kämpften sich durch die zähe Synth-Amneo-Flüssigkeit. Als sie Maria Arenas Ohren erreichten, klang es
wie eine Kettensäge: laut, hartnäckig und unaufhörlich.“
2025-05-17
Eigentlich ist es ein „Mord auf dem Nil“ im Weltall, ein Kammerspiel, bei dem die Umgebung nur von marginalem Interesse ist.
Wichtig ist ja nur, dass die Protagonisten isoliert und von externer Unterstützung abgeschnitten sind. Ob auf einem Raumschiff
oder einer Mond- oder Antarktis-Station ist für die Handlung unerheblich. Es gab Tote und die Lebenden haben keinerlei Plan,
was geschehen ist. Ungewöhnlich ist nur, dass sie selbst sowohl die Ermordeten als auch die Überlebenden sind – denn die Protagonist*innen
sind Klone, die beliebig häufig reproduziert werden können. Man muss also als gegeben akzeptieren, dass Bewusstseinsinhalte wie mp3s
aufgezeichnet und wieder aufgespielt werden können, wenn man das Handy wechselt, bzw. in einem neuen Klonkörper weiterlebt. Der
Konflikt zwischen Klonmenschen, die potenziell unsterblich sind, und ungeklonten Menschen, die absichtsvoll nur ein Leben haben,
gibt die Hauptspannungslinie dieses Zukunftsentwurf ab. Wie diese Welt in 200 Jahren sonst so beschaffen ist – außer dass Essen gedruckt
wird und nicht gekocht – erfährt man nicht. Tatsächlich ist es eine klassische whodunit-Story, bei der es zentral darum geht zu klären,
wer die ganze sechsköpfige Klon-Besatzung des interstellaren Raumschiffs getötet hat. Eigentlich sind es sogar sieben Tote, weil obendrein
die Schiffs-KI komplett betriebsunfähig gemacht wurde. Auch diese nach und nach wiederbelebte KI beteiligt aktiv sich an der Killer-Suche.
Das ist alles leidlich spannend, aber so herzlich wenig an der Zukunft interessiert, dass es recht eigentlich kein Science Fiction Roman ist.
Es werden der Reihe nach die Lebensgeschichten der sieben Protagonist*innen – auch die KI hat eine Vita – von einem allwissenden Erzähler
vorgestellt. Und spätestens nach der dritten Vita hat man spitz gekriegt, dass alle an Bord mit der quasi allmächtigen Unternehmenschefin
zu tun haben, die die Expedition finanziert hat. Eine Art Elon Musk in weiblich, die über dem Gesetz steht und die Strippen zieht. Die
Herleitung der verschlungenen Bezüge unter einander ist mittelmäßig logisch, wie auch die finale Auflösung kaum überzeugen kann. Das
Spannendste am ganzen Text sind noch die Überlegungen zu den moralischen Auswirkungen der Klon-Technik, dass z.B. ein Mord an Klonen
bei gut gesicherten Backups kaum möglich ist und eher eine Form der Abendgestaltung darstellt. Allerdings ist das alles von anderen
Autorinnen schon viel ausgefeilter erzählt worden. Daher reicht es nur für ein: kann man lesen, wenn nichts anderes da ist.
Mur Lafferty
Das sechste Erwachen
München 2018





kann man lesen, wenn nichts anderes da ist.
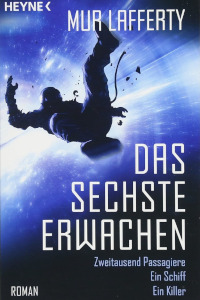
© Heyne-Verlag
Paperback nur noch antiquarisch, lieferbar als eBook (8,99 €)
477 Seiten
ISBN 978-3-641-22179-9 (ePub)
Der erste Satz (und der zweite)
„Wer kämpft, war immer allein. Der Helm registrierte den Schweiß auf Rilas Stirn und trocknete ihn mit einem warmen Luftstrom,
bevor er in ihre Augen laufen konnte.“
2025-05-15
Das Szenario der Geschichte ist der TV-Serie „Battlestar Galactica“ entlehnt: Die kümmerlichen Reste der Menschheit fliehen in einem
zusammengewürfelten Schwarm von Raumschiffen seit langer Zeit unentwegt vor den übermächtigen „Giats“ und jederzeit droht deren letzter,
vernichtender Angriff. Neu ist nur, dass sich dieser Schwarm aus 30 Riesenschiffen zusammensetzt, jedes groß genug um einzigartige Gesellschaftstypen
auszubilden: die einen theokratisch organisiert, die anderen kommunitär, meritokratisch, diktatorisch usw. Das hätte eine spannende Story über
Pluralismus werden können. Allerdings werden gerade einmal drei Schiffe/Sozialsysteme wenigstens etwas ausgemalt. Auf der „Esox“ beispielsweise
hatte eine allmächtige KI die menschliche Besatzung in einem Kollektivbewußtsein zusammengeschaltet – bevor die anderen Schiffe in einem gemeinsam
Militärschlag die KI zerstörten und die Esox unter Zwangsverwaltung stellten. Seither werden die Esox-Bewohner*innen wegen ihrer Tech-Implantate
als Menschen zweiter Klasse behandelt. Die „Squid“ ist ein lebender Organismus und die dort lebenden Menschen verehren das Schiffwesen als Gottheit.
Eine der drei Hauptpersonen, Ugrôn, entwickelt eine intensive mentale Beziehung zu dem Schiffswesen, was ihm die Elite an Bord neidet. Die anderen
beiden Hauptpersonen, Rila und Starn, leben auf der „Marlin“, dem dritten relevanten Schiff. Rila lernt man gleich zu Anfang als Kampfpilotin in
einer Raumschlacht mit den Giats kennen. Ihr beschädigter Jäger wird von der Squid-Besatzung geborgen und schon nimmt die Liebesbeziehung mit Ugrôn
ihren Lauf. Starn arbeitet als Exobiologe, der sich als traumatisierter Ex-Offizier radikal vom Militär losgesagt hat. Und hier wird‘s mal richtig
interessant, denn mit den mörderischen Giats im Nacken, kann der Schwarm nirgends lange bleiben. Treffen sie auf belebbare Welten, beuten sie in der
Kürze der Zeit deren Biosphären maximal aus, um ihre Vorräte aufzustocken. Praktisch betreiben die Menschen also eine üble Raubökonomie, mit den
Exobiologen als Ausbeutungsexperten. Der story plot kreist um solch einen Beutezug in einem System, das von einer raumfahrenden Spezies ohne
interstellare Erfahrung bewohnt wird. Starn müht sich tapfer, die Schäden für die „Cochader“ bei diesem Erstkontakt zu minimieren, aber am Ende
zählt auch für ihn nur das Überleben des Schwarms. Doch bleiben die interessanten Möglichkeiten, die dieses ethisches-Dilemma-Setting bietet,
ungenutzt. Die Cochader erinnern stark an die Star Trek-„Ferengi“: Für sie zählt nur Geld/Profit. Dass die über Geld vermittelte Warenökonomie – erdgeschichtlich eine echte Marginalie – irgendwo im Universum noch einmal erfunden wird: nun ja. Aber dass die Cochader obendrein dem japanischen Modell der Konzernfixierung des ganzen Lebens folgen, ist schon arg plump. Allerdings sind die Cochader ohnehin kaum mehr als Stichwortgeber für die nächste krachende Action. Kampf und Action kann der Autor gut, Liebesgeschichten weniger. Das ist fatal bei einem Plot, der von zwei Liebesgeschichten vorangetrieben wird: Rila & Ugrôn sowie Starn & Prijatu. Letztere ist eine der zwangsabgenabelten Esox-Drohnen und agiert emotionsbefreit – Seven-of-Nine aus dem Star Trek-Universum lässt grüßen. Dass sie für Starn entflammt, sieht man nicht kommen, einfach weil es nicht erzählt wird. Spannender ist die Meritokratie, in der die 30.000 Marlin-Bewohner*innen leben. Über alles wird abgestimmt, wobei der eigene Kompetenzgrad als Gewichtungsfaktor wirkt, OpenSource-Entwickler*innen werden das Konzept erkennen. Leider endet da der Bericht über die Verfasstheit der Bord-Gesellschaft. Kauft man sich seine Brötchen auf der Marlin oder bekommt man eine Zuteilung? Erhalten Menschen mit hohem Kompentenzstatus mehr Zuteilungen? Dürfen sich alle fortpflanzen oder gibt es eine Lotterie? Schweigen. Details gibt es nur über technisches Equipment. Insgesamt zuviel zusammengeklaute Ideen, zuviel banale Handlung und leider gar kein Talent für romantische Annäherungen.
Robert Corvus
Feuer der Leere
München 2017





kann man lesen, wenn nichts anderes da ist.
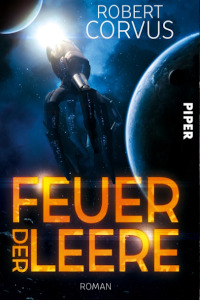
© Piper Verlag
Paperback nur noch antiquarisch
495 Seiten
ISBN 978-3-492-70439-7
Der erste Satz (und der zweite)
„Jenny Nelsons Hände schwitzten in den Handschuhen, als sie nach dem Steuerknüppel griff. »In Ordnung, ich übernehme.«“
2025-01-26
Auch dieses Buch habe ich während eine längeren Krankheitsphase als Hörbuch gehört, was ein wenig die Maßstäbe verschoben hat:
Mir kam es vor allem darauf an, dass Zeit vergeht, und das tat sie beim Hören dieses Buches zuverlässig... Das Buch handelt
von einer sehr nahen Zukunft, faktisch spielt es in einem Setting, das von der Jetztzeit nicht zu unterscheiden ist, alle
beschriebenen Technologien sind verfügbar und real. Das Szenario erinnert stark an „Die letzte Astronautin“ (2020), in beiden
Büchern gibt ein überstürztes Wettrennen zu einem Zielpunkt im Sonnensystem, an dem sich die Konkurrentinnen Zugriff auf
spektakuläre Alientechnologie versprechen. Der Autor – im ersten Leben Raumfahrtingenieur – wuchert damit, dass er sich
sowohl in technischen Dingen, wie auch bei der bürokratischen Organisation der staatlichen Raumfahrt richtig gut auskennt.
Gerade das erste Drittel des Buches kann sich kaum entscheiden, ob es eine dröge Darstellung des Astronauten-Alltags auf
der Erde mit all den kleinlichen Intrigen und internen Behördenmachtkämpfen sein will oder ein actionreicher Spionagethriller.
Die Hauptfiguren sind Jenny und Daniel, eine ehrgeizige NASA-Astronautin und ein NASA-Manager, die irgendwie auch eine
Liebesbeziehung pflegen, was aber unterbelichtet und für die Story unerheblich bleibt. Gemeinsam kommen die beiden einer
hoch-geheimen chinesisch-russischen Raummission zum Mars-Mond Phobos auf die Spur, was dazu führt, dass die USA plötzlich
alles daran setzen, schneller als die Konkurrenz dorthin zu gelangen. In kürzester Zeit wird aus umgewidmeten, vorhandenen
Elementen ein Schiff zusammengeschustert, das zum Mars fliegen kann. Das zweite Drittel der Geschichte handelt von dieser
abenteuerlichen, weil völlig überhasteten Mission. Hier ist die technische Detailverliebtheit des Autors ein Bonus, denn
die vielen kleinen Fast-Katastrophen der unzulänglichen Technik treiben den Plot voran. Leider hat das Militär hat mal
wieder die Rolle der Arschgeigen, die immer irgendwo eine versteckte Atombombe mitschleppen, um im Bedarfsfall alles in
die Luft zu jagen. Dieser Antagonismus von grundvernünftigen NASA-Leuten, die eigentlich nur auf Kooperation und Frieden
aus sind, und dumpf-sturen Militärs, die prinzipiell erst schießen und dann fragen, ist sattsam bekannt. Aber wie schon
im frühen Roland Emmerich-Film „Stargate“ (1994) findet Jenny am Ende heraus, dass es ohne die harten Hunde mit ihrer
Atombombe nicht geht. Das Finale ist herzlich unglaubwürdig und wenn die Schlusspointe andeuten will, dass uns Menschen
hier auf der Erde nur ein glaubwürdiger Feind im Weltall fehlt, damit wir die Kriege untereinander hinter uns lassen
können, dann hinterlässt diese Art von „happy end“ einen mehr als schlechten Geschmack im Hals. Aber wäre der Rest ungefähr
so spannend und unterhaltsam wie das zweite Drittel, hätte ich das Buch als grundsolide SciFi-Lektüre besser bewertet.
Phillip P. Peterson
Janus
München 2023





kann man lesen
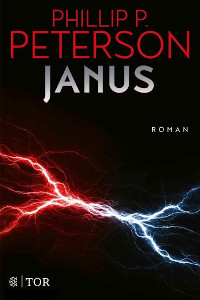
© S. Fischer Verlag | Tor
Paperback (18 €)
382 Seiten
ISBN 978-3-596-70892-5
Der erste Satz (und der zweite)
„Der orangefarbene Gasgigant Zeus hing tief über dem Horizont und schimmerte vor dunklem Grund. Ringsum funkelte ein Sternenfeld
im schwarzen All.“
2025-01-12
Habe ich als Hörbuch auf einem großen Streamingdienst gehört statt gelesen. Die Exposition war so eindeutig idyllisiert, dass
man auf den zwingend zu erfolgenden Einbruch des unfassbaren Schrecklichen eher genervt wartete. Es kam dann auch und ich spoilere
nur minimal, wenn ich verrate, dass nach 40 Seiten alle Protagonisten der Anfangssequenz tot sind – ungewollt getötet von der Heldin,
die damit alle Kriterien für eine griechische Tragödie erfüllt hätte: unentrinnbar unschuldig schuldig.
Aber wir sind hier in einem US-amerikanischen Universum und das kennt nur eine Geschichte: ein schmerzensreicher Heiland muss die Welt
(hier: das bewohnte Universum) erretten. Überraschend schlägt diese Heilsgeschichte im zweiten Viertel um in eine Quest nach einem
magischen Artefakt, das Herrschaft über das Universum verspricht. Und ich verrate wiederum nicht zuviel, wenn ich kundtue, dass dieses
Artefakt in der zweiten Hälfte des Romans keinerlei Rolle mehr spielt. Spätestens hier hätte das Lektorat intervenieren und darauf
drängen sollen, sich für einen Erzählmodus zu entscheiden. Wenigstens in einer Hinsicht ist das Buch sehr konsequent: Die Geschichte wird
ausschließlich aus der Ich-Perspektive der Heldin ohne irgendwelche Zeitsprünge linear erzählt, einzig unterbrochen von Flashbacks
in ein Alien-Bewusstsein – das aber auch zum Ich-Bewußtsein der Heldin gehört. Diese Alien-Passagen macht der Autor durch eine
archaische Sprache kenntlich, besonders schön in der monomanischen Wiederholung fester Fügungen, wie „der große und mächtige Ctein“.
Ctein kann ohne seine Attribute nicht genannt werden. Leider versaut der Autor das, indem er zwischendurch in alttestamentarischen
Stil wechselt. Genesis oder Trojanischer Krieg, eins von beiden, hätte die Lektorin hier brüllen sollen. Sehr lange Abschnitte sind
wüste Hau-drauf-Action, wo es zischt und kracht und wundersamer Weise keine der relevanten Hauptpersonen ernstlich verletzt wird.
Da kann man seinen Spaß dran haben und wird gut unterhalten. Leider gibt es auch längliche Abschnitte, die der Intraspektion der Heldin
gelten. Und die gehen ungefähr so: Was würde sie am Ziel der Reise erwarten? Würden sie Erfolg haben oder kläglich scheitern? So etwas
heißt dann wohl fachsprachlich „ein retardierendes Element“, man kann es aber auch einfach öde nennen. Und wenn es am Ende zur
Vergöttlichung kommt, geht die Logik besser schlafen. Wäre die Charakterzeichnung der Hauptpersonen etwas über die Binsenweisheit
hinaus gegangen, dass eben jede ihr Päckchen zu tragen hat, hätte es für eine mittelgute Space Opera gereicht. Unabhängig davon ist
das Werk einfach mindestens 300 Seiten zu lang. Aber: Wenn man mit Corona kraftlos auf dem Krankenlager dämmert und einem vom richtigen
Lesen schon nach einer halben Stunde der Kopf dröhnt und platzt, dann ist dieser Roman als Hörbuch herrlich! Es macht überhaupt nichts,
wenn man zwischendurch für eine Stunde wegdämmert, denn das Ganze dauert über 32 Stunden und man fließt einfach mit dem Wortestrom
dahin. Dafür die Buch wirklich gut.
Christopher Paolini
Infinitum. Die Ewigkeit der Sterne
München 2020





kann man lesen wenn nichts anderes da ist oder man komatös auf dem Krankenlager dämmert.
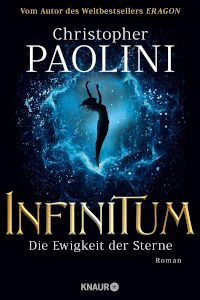
© Knaur Verlag
Hardcover (24 €)
960 Seiten
ISBN 978-3-426-22736-7
Der erste Satz (und der zweite)
„Luise saß auf dem Deck eines Katamarans und genoss einen vierzig Jahre alten Chardonnay zu ihrem Steak aus Kobe-Rind,
das sie in einer Pfütze aus Blut und Fett mit ihrem Messer zerteilte. Das Fleisch war wunderbar marmoriert, und jeder Bissen,
den sie sich andächtig in den Mund steckte, wurde von den erhabenen Blasgeräuschen der Wale begleitet, die sich im Wasser
um das Boot tummelten.“
2024-10-15
Am Ende des 21. Jahrhunderts ist die Erde durch die Klimakatastrophe weitgehend unbewohnbar geworden. Nur in den wenigen Technologie-Hochburgen
lässt sich das dank beliebig verfügbarer Energie einfach ignorieren. Die Menschen sind „augmentiert“, also durch Genmanipulation und Implantate
zu praktisch unsterblichen Superbrains mutiert. Da jedoch der Kapitalismus unverändert herrscht, kriegen nur die Produktiven diese Benefits, die
anderen kommen als „Überflussmenschen“ in Reservate und sterben ganz wie die First Nations vor ihnen allmählich aus. Alle Veränderung findet jedoch
nur im Technischen statt, die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern sich schlicht nicht. Die heterosexuelle Kernfamilie bleibt die Basis und
die Techno-Konzerne herrschen. Im Zentrum des Romans steht die Angst vor der Erschaffung einer allmächtigen, gottgleichen KI, die die Menschen
nur noch lästig und überflüssig findet. Dieses unerwünschte Auftreten einer KI-Gottheit wird mit dem titelgebenden, wenngleich sinnfreien
Begriff „Singularität“ belegt. Thematisiert wird aber auch die sehr gegenwärtige Angst, durch KI-Einsatz den Job zu verlieren. Hier wird das
jedoch nicht anhand von Busfahrerinnen erzählt, die von autonom fahrenden Bussen überflüssig gemacht werden, sondern in 80 Jahren trifft es
selbst die genetisch und elektronisch aufgerüsteten Superbrains in den avanciertesten Technikberufen, die durch immer bessere KIs abgeschafft
werden. So gesehen ist das finale Auftreten der KI-Gottheit einfach nur die Abschaffung sämtlicher Jobs – und da in der Welt dieses Autors
verhungern muss, wer nicht arbeitet, stirbt die Menschheit dann notwendig aus. Die Idee, dass stattdessen der Überlebenskampf ein Ende hätte
und ohne Lohnarbeit für alle gesorgt würde, verwirft Tree beiläufig: In der dahin dämmernden EU habe man es mit dem bedingungslosen Grundeinkommen
versucht und sich selbst damit zum Abstieg bis zum Zusammenbruch verurteilt. Es gibt drei separate Handlungsstränge, die scheinbar in einer Zeitebene,
aber unverbunden stattfinden. Ein Strang spielt in einer Simulation einer Koloniebildung auf dem Exoplaneten Proxima B, einer handelt von den
Heranwachsenden Adam und Utah in einem der letzten Reservate für genetisch unveränderte Menschen und der dritte spielt in der Hightech-Enklave
New York. Hier wird James, ein weiterer Überflüssiger, von den Augmentierten wie ein Haustier gehalten. Seine Emanzipation, die damit beginnt,
dass er mit der Suche nach der seit 20 Jahren verschollenen Luise beauftragt wird, bildet das Zentrum der Gesamtstory. In allen drei Stränge
zerbricht nach einer ruhigen Exposition der Alltag durch einen Gewalteinbruch, der für die jeweilige Held*innen zunächst unerklärlich bleibt.
Danach taumeln sie durch immer neue, schwierige Situationen. Besonders krass trifft es den 12-jährigen Adam, der sich nach der Vernichtung
seines Reservats gemeinsam mit seiner Freundin Utah in einer absolut lebensfeindlichen Welt durchschlagen muss. Das wird alles spannend erzählt
und phasenweise entwickelt sich der Roman zu einem echten Pageturner. Wenn nur nicht das Plotgerüst so viele logische Lücken hätte! Das
fängt schon mit dem rätselhaften Ausgang des Prologs an, bei dem eine Zentralfigur ermordet wird, die aber in der restlichen Geschichte höchst
lebendig ist. Auch warum Luise eigentlich verschwunden ist, wird nicht aufgeklärt. Stattdessen findet James sie einfach umstandslos, kaum dass
er zur Suche aufgebrochen ist. Und wer am Ende wem auf Proxima B ins Handwerk pfuscht – unklar. Was wirklich in Tiefe verhandelt wird, ist das
Problem der perfekten Simulation. Das ist zwar nicht originell – immerhin hat Fassbinder seinen bahnbrechenden Fernsehfilm „Welt am Draht“
schon 1973 gedreht –, aber gut gemacht. Zu seinem eigentlichen Thema, wie KI die Welt verändern wird, hat der Autor wenig mehr beizutragen
als Angst zu verbreiten.
Joshua Tree
Singularity
Frankfurt am Main 2021





größtenteils gut zu lesen.

© S. Fischer Verlag | Tor
Paperback (17 €)
455 Seiten
ISBN 978-3-596-70087-5
Der erste Satz (und der zweite)
„Wolken jagten im Südosten dahin wie fliehende Pferde. Der Taifun Saola braute sich zusammen.“
2024-10-13
Man merkt, dass der Roman im chinesischen Original schon 2013 erschienen ist – das heutige China hätte eine deutlich andere
Hintergrundfolie abgegeben. Erwähnt werden gerade noch die Wirtschaftsreformen der Ära Deng Xiaoping, aber mehr Bezugnahme auf
die politische Realität ist nicht. Das alte, vorkommunistische China jedoch und dessen immer noch wirksamen primordialen
Sozialformen sind Chen klar verhasst, daran lässt seine Figurenzeichnung keinen Zweifel. Tatsächlich kommt der Roman mit sechs
Handlungsträger*innen aus: der US-amerikanische Agent und sein Dolmetscher – sie stehen für den Westen und die verwestliche
chinesische Jugend. Der Clanchef und sein pathologischer Killer – sie repräsentieren das verkommene alte China. Und das „Müllmädchen“
(eine Wanderarbeiterin) und ihr Mentor, der als Hacker der Unterdrückten seine eigenen mörderischen Ziele verfolgt. Stilisch
changiert der Roman immer wieder zwischen extrem poetisch-blumige Passagen, eher plumper politischer Analyse und hochtechnischen
Detailschilderungen. Jedenfalls als Liebesroman ist das Buch ein Fehlgriff, obwohl die Story in weiten Teilen davon lebt, dass
zwei der Hauptfiguren – der Dolmetscher und das „Müllmädchen“ – sich trotz der gewaltigen Kluft, die sie hinsichtlich Klasse und
Sozialordnung trennt, in einander verlieben. Nur kommt diese Liebe nie über einen Kuss hinaus, für den Dolmetscher heißt es vor
allem, seine Geliebte immer wieder zu suchen, um sie vor Ungemach zu schützen. Dieser unglücklich Liebende ist als Grenzgänger
zwischen China und dem Westen (= USA) angelegt, aber noch wichtiger ist seine Grenzüberschreitung als gebürtiger Chinese
zwischen den Einheimischen und den Wanderarbeiter*innen. Denn Chen geht es um das himmelschreiende Unrecht, dem diese Ausgebeuteten
ausgesetzt sind. Sie müssen ungeschützt giftigen Müll sortieren und verarbeiten, sind ständig schädigenden Dämpfen ausgesetzt,
hausen im Müll, haben kaum zu essen. Werden sie aber krank oder verunglücken wegen der nicht vorhandenen Arbeitssicherheit, steht
sofort eine andere Wanderarbeiter*in bereit, um den elenden Job zu übernehmen. Das Übelste an dem ganzen System sind aber die
mafiösen Familienclans, die alle Jobs und Warenströme kontrollieren. Sie sind de facto auf Patronage und Vassalität gegründet,
also feudal, tarnen sich aber als Blutverwandtschaftsnetze. Nur die Wanderarbeiter*innen – hier verächtlich „Müllmenschen“
genannt – sind von der Patronage ausgeschlossen, sie müssen froh sein zu überleben. Damit nicht genug ist da auch noch die
weltumspannende Ausbeutung durch böse globale Konzerne, die krebsverursachende und umweltzerstörende Produktionsprozesse in
Länder auslagern, die ihre Arbeitskräfte gesetzlich kaum schützen. In diesem Fall schickt ein US-Großkonzern einen als Manager getarnten
Agenten nach China, um dort das Recycling giftigen Elektromülls unter Dach und Fach zu bringen. Irgendwann wird dieser dann als
hit man – also zum Töten ausgebildeter Geheimagent – enttarnt. Was die Frage aufwirft: Warum entsendet ein Konzern einen
als Manager getarnten Killer, um das zu besorgen, was ein Manager üblicherweise erledigt: Verträge abschließen, die gut für den
Konzern, aber nachteilig für die Vertragspartner sind? Letztlich dient dieser ganze Strang allein dazu, die Kollaboration der
ganz auf ihren Machterhalt bedachten einheimischen Eliten mit den Konzernen anzuprangern. Komischerweise tauchten Staatsfunktionäre
nur als Marionetten der Clanschefs auf. Ob es in diesem China der nahen Zukunft überhaupt noch eine allmächtige kommunistische
Partei gibt oder nicht, bleibt offen. Wenig überzeugend. Bleibt also nur der andere Erzählstrang, der Dolmetscher und seine Liebe
zu der Wanderarbeiterin. Bloß wird dieses „Müllmädchen“ von einem Virus aus einem Geheimprojekt des Konzerns verseucht, der aus
ihr wundersam eine KI macht. Zumindest ist all das, was sie nach ihrer Kontaminierung tut und die Kräfte, die ihr dann zuwachsen,
genau das, was sonst üblicherweise eine KI ausmacht: Sie kann alles Elektronische kontrollieren, kann Milliarden Informationen
gleichzeitig verarbeiten, ist emotionsbefreit und würde natürlich die Weltherrschaft übernehmen. Das ist zwar wirklich originell
– eine KI ohne Computer –, dreht aber den Fokus der Geschichte gegen Ende so weit weg vom Elend der Ausgebeuteten zu blanker
Action, dass der Roman sich irgendwo verliert.
zurück zu den jüngsten Einträgen
(2025-05-19 bis ...)
weiter zu den nächst älteren Einträgen
(2024-05-14 bis 2024-09-28)
Qiufan Chen
Die Silizium-Insel
München 2019 (2013)





kann man lesen.

© Heyne Verlag
Paperback (nur noch antiquarisch)
459 Seiten
ISBN 978-3-453-31922-6