Max sein SciFi-Blog (2019-06-04 bis 2019-08-04)
Anfänge meiner persönlichen Anmerkungen zu Science Fiction
Hier finden sich meine ersten sechs Rezensionen (ein Klick auf das entsprechende Cover führt direkt zum gewünschten Buch):
Hinweis am Rande:
Meine Bewertungsskala eicht sich an Werken wie The left hand of darkness von LeGuin, Es ist nicht leicht ein Gott zu sein von den Strugatzkis oder Eden von Lem. Die bekommen von mir volle fünf Sterne.
Der erste Satz (und der zweite)
„In einem weißen Raum am Rand des Sinus Medii sitzen sechs nackte Teenager. Drei Mädchen, drei Jungen.“
2019-08-04
Toller Schmöker! Endlich mal wieder ein Versuch, die Zukunft zu denken – ein Gesellschaftsentwurf, der anders ist als
das Heutige oder das Gestrige. McDonald sucht sich zudem ein Feld, auf dem das radikal Andere gebastelt wird, das bislang
kaum jemand anderes beackert hat: das Recht. Auf dem Mond gibt es kein Kriminalrecht, es steht nichts per se unter Strafe.
Es sind keine Normen gesetzt, die ein Rechterzwingungsapparat (= Staat) durchsetzt, sondern alles ist verhandelbar – auch
die Tötung eines Menschen. Es gibt kein Recht auf Leben, keine Menschenrechte. Wer kein Geld mehr hat, erstickt, weil ihm
oder ihr die Luft abgedreht wird, sobald kein Geld mehr fließt. Ein Mord kann also so laufen, dass man dem Sauerstoffversorgungsvertrag
eines Menschen aufkauft, dem Provider viel mehr Geld bietet, als dieser vom Endverbraucher erhält, und dann die Luft
abdrehen. Tötungen werden von keiner übergeordneten Instanz geahndet. Die Macht teilen sich fünf Firmen, die jeweils einem
Clan gehören. Diese Clans bilden die Aristokratie, was heißt, sie haben Geld und kleine Armeen. Jeder Clan hat ein paar
hundert Killer*innen unter Vertrag. Die Geschichte handelt nun vom endlosen Machtgerangel der Clans, die untereinander mal
heiraten und dann wieder die Produktionsanlagen der anderen in die Luft jagen (oder genauer: ins Vakuum). Im Zentrum stehen
die Cortas, die Underdogs unter den Clans. Auch das ist eine Besonderheit: alle Clans sind ethnisch verortet. Die Cortas
sind Brasilianer, die Asamoahs sind Ghanaer, die Mackenzies sind Australier. Es wimmelt daher vor ungewohnten Orixás-Göttern
und -Traditionen, Adinkra-Symbolen etc. Lustig für mich war, dass das Feld, auf dem sonst die avanciertesten alternativen
Gesellschaftsentwürfe erschaffen werden, die Geschlechterbeziehungen, vom Autor einfach beiläufig abgeräumt wird: Auf dem
Mond geht alles, wirklich alles: Die Ehe zu fünf, das schwule Paar, die Autoerotikerin, das Neutro, das vertraglich geregelte
Vögelnetzwerk – anything goes! Geschlechterbeziehungen haben kein erkennbares Gewicht. Sex hingegen ist allgegenwärtig, spielt
aber ebenfalls – bis auf eine ausführlich durchdeklinierte Szene – keine wichtige Rolle. Auch ist angenehm, dass der Autor eine
stimmige Sprache für die wenigen Sexszenen hat, sie sind weder hyperpeinlich, noch stockkonservativ oder völlig stumpf.
Irritierend bleibt ein Erzählstrang, der quer in diesem sonst sehr glaubwürdigen SF-Szenario steckt, weil es ein klassisches
Fantasy-Topos ist: Der jüngste Sohn der Corta-Matriarchin ist ein Werwolf. Wozu das gut ist für die Geschichte, bleibt offen,
weil sich das Buch am Ende mal wieder als Band 1 einer Reihe entpuppt. Ich frage mich, warum heute niemand mehr glaubt, eine
Geschichte auf immerhin 500 Seiten vollständig erzählen zu können. Nach dem obligatorischen Kliffhänger kommt also die Werbung
für Band 2 mit dem Titel: Wolfsmond. Es steht daher zu vermuten, dass dieser Fantasyplot im weiteren Verlauf eine
größere Rolle spielen wird.
Ian McDonald
Luna
München 2017





macht Spaß zu lesen
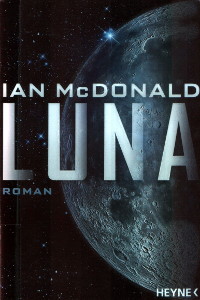
© Heyne Verlag
Paperback (15 €)
511 Seiten
ISBN 978-3-453-31795-6
Der erste Satz (und der zweite)
„Mir ist schwindlig vom Reiswein. ‚Okay, teilt die Karten noch einmal aus‘, sagt James und lässt die Hand über den Tisch kreisen.“
2019-08-03
Variation auf ein bekanntes und bewährtes SF-Thema: die zerstrittenen Völker der Erde überwinden ihre Ego- und Patriotismen im Angesicht einer
nicht-menschlichen Bedrohung. Hollywood hat das Thema besonders schön in Independence Day bebildert. Der Einigungsprozess findet hier nun
auf dem Mars statt, und das wechselseitige Misstrauen der Amerikaner, Russen und Chinesen in einem sehr kleinen Mars-Habitat wird ausführlich
zelebriert. So weit, so gut. Mein Interesse sank abrupt, als klar wurde, wie die Bedrohung nun wirklich aussah. Ungewöhnlich bleibt, dass der
Geliebte der Heldin – ja, die Hauptfigur ist weiblich – nach der Hälfte des Buches tot ist. Kein Irrtum, kein Happy End. Um so weniger kann
seine Spiegelung in einer KI im zusammenhangslos angepappten Epilog überzeugen. Alles im allem handelt es sich mehr um ein Drehbuch für
einen Actionfilm als einen Roman. Cawdron macht sich nicht die Mühe zu ergründen, was 50 Jahre Entwicklung mit der Gesellschaft, mit den
Geschlechterbeziehungen, mit den Religionen, den Modetrends oder der Musik, ja eigentlich mit überhaupt irgendwas machen. Alles ist genauso
wie heute, nur dass dieses Heute auf dem Mars spielt, wo die Schwerkraft etwas geringer ist. Das ist enttäuschend. Dabei war das Szenario,
dass die Nabelschnur zur Erde gewaltsam gekappt wird und die Marskolonie sich gezwungenermaßen eigenständig entwickeln muss, gut! Das hätte
Potenzial gehabt. So lässt der Autor einen Krieg auf dem Mars wüten, bei dem es den Kolonist*innen offenbar völlig egal ist, ob für die Sieger*innen
die nicht ins Vakuum gesprengten Ressourcen noch länger zum Leben reichen. Phasenweise ist die Action spannend, am Ende ärgert man sich nur
noch.
Peter Cawdron
Habitat
München 2019





muss man echt nicht lesen
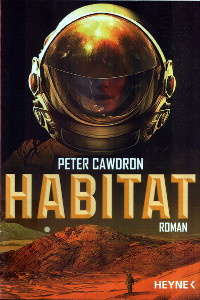
© Heyne Verlag
Paperback (13 €)
341 Seiten
ISBN 978-3-453-31963-9
Der erste Satz (und der zweite)
„Auch die Meuterer wären, wenn die Ströme nicht kollabiert wären, damit durchgekommen. Natürlich gibt es innerhalb der Gilde eine legale
Vorgehensweise für eine Meuterei, ein Protokoll, das seit Jahrhunderten befolgt wird.“
2019-07-18
Ein 400-Seiten-Wälzer, der eindeutig als Teil 1 einer Roman-Serie angelegt ist, also mit einem abrupten Kliffhänger endet.
Aber geschenkt, Science Fiction ist im 21. Jahrhundert ohnehin selten unter 1.000 Seiten zu haben. An Scalzis zynischem Grundton,
den man auch für Humor halten kann, hat sich seit Krieg der Klone (2007) wenig geändert. Drei Hauptfiguren (allesamt Adelige,
denen es nie an Kleingeld mangelt) steuern in recht vorhersehbaren Bahnen auf ihre Begegnungen zu. Etwas müde, anfangs sogar fast
biedermeierlich ist der Handlungsstrang der Thronerbin wider Willen (Cardenia). Bis eine Bombe Cardenias einzige Freundin im Palast
in Stücke reißt. Überhaupt brechen in Kollaps immer wieder brutale Tötungsszenen in die ansonsten etwas dialoglastig dahin
plätschernde Handlung ein. Zwar müht sich Scalzi stets um eine ironische Brechung der ausschweifenden und hohlen Hofrituale,
aber die Figur der Cardenia kommt auch nach hunderten Seiten aus ihrer Kleinkind-Rolle nicht heraus. Dass sie ausersehen ist,
die Partnerin des edlen Provinz-Wissenschaftlers (Marce) zu werden, riecht man auf 100 Seiten gegen den Wind, aber wer wie ich
auf ein romantisches Tête-à-tête hofft, wird auf Band 2 warten müssen. Dafür vögelt sich Heldin Nr. 3 (Kiva) durch ihren
Handlungsstrang, ohne dass dieser Sex für die Story irgendeine Rolle spielen würde. Aber keine Angst, auch die prüdeste Leser*in
kann das Buch gefahrlos lesen, denn jeder Doris-Day-Film ist expliziter als Scalzi. Lady Kiva wird ansonsten durch ununterbrochenes
Fluchen gekennzeichnet, was aufgrund der geringen Variationsbreite der Flüche (sämtliche möglichen Ableitungen von „Fick“ und „Arsch“)
mit der Zeit langweilig wird. Die häufigste Redewendung des Romans ist allerdings „sagte er“ oder „sagte sie“ – striche man diese
Kombination aus dem Text, wäre er gefühlt um 30 Seiten kürzer. Alles in allem kann man das Buch lesen, die meiste Zeit wird man ganz
gut unterhalten. Wer nicht mehr erwartet, wird nicht enttäuscht.
John Scalzi
Kollaps. Das Imperium der Ströme
Frankfurt am Main 2017





kann man lesen

© Fischer Verlag
Paperback (15 €)
416 Seiten
ISBN 978-3-596-29966-9
Der erste Satz (und der zweite)
„Auf Brin-2 gab es keine Fenster – durch die Rotation war ‚draußen‘ immer gleichbedeutend mit ‚unten‘, unter den Füßen, aus dem Sinn.
Die Wandmonitore erzählten eine hübsche Geschichte, zeigten ungeachtet der ständigen Umdrehung eine zusammengesetzte Ansicht der Welt
unter ihnen, so als würde der Planet bewegungslos im Raum schweben: ein grünes Juwel, entsprechend dem zwanzig Lichtjahre entfernten
blauen Juwel ihrer Heimat.“
2019-07-01
Das Buch fing so gnadenlos schlecht an, dass ich es nach fünf Seiten schon fast beiseite legen wollte. Aber die Story kriegt dann doch noch
den Bogen und wird recht spannend. Sie spielt auf zwei Ebenen, eine auf einem unfreiwilligen Generationen-Raumschiff und
die zweite auf einem Planeten, auf welchem eine genmanipulierte Spinnenart die dominante Spezies wird. Man fühlt sich wiederholt
an Eine Tiefe am Himmel erinnert, wobei Vernor Vinge das Thema einer nicht-menschlichen Entwicklung über viele Generationen
reizvoller erzählt hat. Trotzdem ist der Spinnen-Teil der deutlich bessere, denn im Raumschiff-Teil stolpern die Hauptfiguren
stoisch oder trottelig von einer Katastrophe zur nächsten, bis die Leser*in ermüdet oder gelangweilt ist. Die Jahrhunderte
überdauernde Liebesgeschichte zwischen dem Historiker und der Ingenieurin rettet den Plot leider auch nicht. Die Auflösung
am Ende ist recht lustig, aber auch diesen Twist hat man in dem Film Phase IV von 1974, als die Ameisen die Herrschaft übernahmen,
schon gesehen. Insgesamt keine Empfehlung, aber bevor einem die Decke vor Langeweile auf den Kopf fällt, kann man auch
diesen Roman lesen.
Adrian Tchaikovsky
Die Kinder der Zeit
München 2018





kann man zur Not lesen

© Heyne Verlag
Paperback (16 €)
672 Seiten
ISBN 978-3-453-31898-4
Der erste Satz (und der zweite)
“The Deliverator belongs to an elite order, a hallowed subcategory. He's got esprit up to here.”
2019-06-08
Ein früher Roman von Stephenson, von dem ich bis dahin nur die beiden deutlich aktuelleren Bücher Anathem (2010) und Amalthea (2018) gelesen
hatte. Kurz vor dem Urlaub bekam ich Snow Crash nur auf Englisch, denn die deutsche Ausgabe ist lange vergriffen – da hätte ich früher
aufstehen und ein gebrauchtes Exemplar jagen müssen. Aber ich dachte, mein Englisch ist gut genug, dann lese ich's halt im Original. Hustekuchen,
sage ich nur, das Buch brachte mich fast noch mehr an meine Grenzen als The Yiddish Policemen's Union von
Michael Chabon – und schon das war ein Höllenritt der Sprache. Aber Stephenson toppt das noch einmal, irgendwann habe ich es aufgegeben, jedes Wort
und jede Slang-Redewendung verstehen zu wollen und bin einfach dem Flow der Sprache gefolgt. Das Grundkonzept, das sich erst relativ spät im Roman
offen entfaltet, ist Held versus Anti-Held, Hiro versus Raven. So weit, so einfach. Das Setting, ein Los Angeles in naher Zukunft, ist allerdings
alles andere als einfach. Es ist nicht plump apokalyptisch, es gab keinen Dritten Weltkrieg, statt dessen hat die ganze USA einen kompletten Rückzug
aller Staatlichkeit durchlebt und die Welt funktioniert nun ohne übergeordnete staatliche Instanzen. An die Stelle des Staates sind Franchise-Ketten getreten,
lustiger Weise ist die Mafia auch nur eine solche Franchise-Kette – sie dealt in Pizza, aber wer dem Chef, Onkel Enzo, dumm kommt, wird ganz
wie früher erschossen. Jeder Pizzaladen wird auf diese Weise zu einem Mini-Staat, ein „Franchulat“, in dem nur die Regeln dieser Franchise-Kette
gelten. Jede/r kann Mitglied eines oder mehrerer Franchise sein und genießt, solange er/sie sich auf dem jeweiligen Territorium aufhält, dessen
Schutz und/oder dessen terrorisierenden Regeln. Kirchen, Hotelketten, Hardware-Stores oder Gated Communities – alles kann sich zu solch einem
Franchise entwickeln. Und dann gibt es noch die „Kouriere“, ein Parcelservice, der wie eine High-Tech Surfer Gilde organisiert ist. Eine
weibliche Figur, Y.T., ist so ein Kourier. Und Y.T. ist cool as cucumber! Sie ist die heimliche Hauptfigur des Romans. Y.T. ist zwar erst 15,
aber sie radiert bei Bedarf ein halbes Agenten-Hauptquartier aus. Natürlich geht es auch um eine riesige Weltverschwörung, Hiro muss das Rätsel
des Monotheismus und der Glossolalie lösen, wobei eine Kenntnis aller sumerischen Göttinnen echt hilfreich ist, aber in Wirklichkeit geht
es um Y.T. Um so enttäuschender, dass ausgerechnet die coole Socke Y.T. eine Affäre mit dem irren Inuit-Killer Raven anfängt. Und Hiro
bekommt am Ende – nachdem er in einem ganz klassischen Zweikampf gegen Raven angetreten ist – seine Traumfrau, nur lässt einen das kalt, weil
diese Frau im ganzen Roman auf vielleicht 10 Seiten auftaucht. Liebesgeschichten sind nicht wirklich Stephensons Stärke. Aber die wilden
Twists seiner Story sind unbedingt lesenswert! Und wenn man sich vor Augen hält, dass dieser Roman im Jahr 3 des Internets veröffentlicht
wurde – 1992 hatte ich nicht mal eine eMail-Adresse! –, dann ist sein Entwurf eines zweiten, selbstgestrickten Lebens in der virtuellen Realität
(hier: das Metaverse) schlicht genial. Stephenson hat das Ganze zwar nicht erfunden, aber er hat es auf eine Weise ausgesponnen, die auch
heute noch standhält. Insgesamt: wild, weird, trashig und sehr unterhaltsam.
Neal Stephenson
Snow Crash
New York 2017 (32. Aufl., Erstveröffentl.: 1992)





gut zu lesen
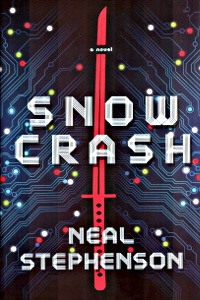
© Del Rey Trade
Paperback (18 €)
in Englisch
559 Seiten
ISBN 978-0-553-38095-8
Der erste Satz (und der zweite)
„Die Scopuli war vor acht Tagen geentert worden, und jetzt war Julie Mao bereit, sich erschießen zu lassen.
Sie hatte acht Tage in einem Spind hocken müssen, bis dieser Entschluss gereift war.“
2019-06-04
Ein echter Weltraum-SF-Roman – die ganze Geschichte spielt auf Asteroiden, Monden oder gleich in Raumschiffen. Es gibt auch Gefechte
und Soldat*innen in Raumanzügen, die wild im Vakuum herum ballern. Aber das ist nicht der Hauptfokus dieser Geschichte, es ist die Geschichte
zweier Männer, Holden und Miller, deren Leben aus den Fugen geht. Es gibt auch zwei Liebesgeschichten, allerdings liebt der eine, Miller,
eine Art Untote (nein, es ist kein Zombie-Roman), mit der er in der zweiten Hälfte des Romans ständig Zwiegespräche in seiner Fantasie führt.
Miller ist der klassische abgehalfterte Cop, geschieden, gescheitert und versoffen – ein Klischee, wie von Raymond Chandler geschrieben.
Und dieser Cop entwickelt eine Obsession für einen seiner Fälle, eine spurlos verschwundene junge Frau. Holden ist mehr der
klassische SF-Held, gut aussehender Erster Offizier eines Raumfrachters und Womanizer im Nebenberuf, der – kaum dass die Exposition beendet
ist – selbst das Kommando übernehmen muss und regelmäßig übers Ziel hinausschießt. Seine Liebesgeschichte ist schön konventionell, er muss
erst noch herausfinden, wen er wirklich will, aber das schafft er schon, keine Sorge. Rassismus ist ein Dauerthema im Roman und Corey geht
erfreulich reflektiert damit um. Holden und Miller überstehen unfreiwillig zusammen wildeste Abenteuer, ohne je wirklich Buddies zu werden
– wäre es ein Hollywood-Film, wäre das der Fluchtpunkt, auf den alles zustrebt – und auch das hat auch einen rassistischen Twist. Insgesamt
ein gelungener Roman, der gekonnt die Balance hält zwischen Space Opera, Film noir und interplanetarer Schnitzeljagd. Selbst dass der Autor
der Versuchung nicht widerstehen konnte, die Geschichte zu einem achtbändigen Romanzyklus auszuwalzen, stört am Ende dieses ersten Romans nicht,
finden doch alle Handlungsstränge nach 650 Seiten ein befriedigendes Ende.
Postscriptum: Als ich diese erste Rezension schrieb, war mir weder bekannt, dass dieser Roman schon drei Jahre zuvor zu der US-amerikanischen TV-Serie „The Expanse“ verwertet worden war (die mittlerweile in die fünfte Staffel geht), noch dass Corey ein Pseudonyn für Daniel James Abraham und Ty Franck ist. Ändert alles nichts daran: Das Buch ist gut (die Fortsetzung nicht).
zurück zu den nächst jüngeren Einträgen
(2020-02-29 bis 2021-01-17)
James Corey
Leviathan erwacht
München 2012





macht Spaß zu lesen
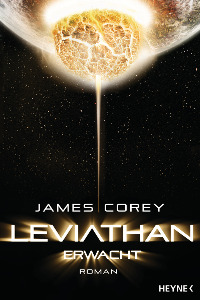
© Heyne Verlag
Paperback (15 €)
654 Seiten
ISBN 978-3-453-52931-1