Max sein SciFi-Blog (2020-02-29 bis 2021-01-17)
Übersicht
Hier finden sich die folgenden Rezensionen (ein Klick auf das entsprechende Cover führt direkt zum gewünschten Buch):
Hinweis am Rande:
Meine Bewertungsskala eicht sich an Werken wie The left hand of darkness von LeGuin, Es ist nicht leicht ein Gott zu sein von den Strugatzkis oder Eden von Lem. Die bekommen von mir volle fünf Sterne.
Der erste Satz (und der zweite)
„Ein geiler Arsch rettete Calvary Doyle das Leben. Der geile Arsch zockelte, zusammen mit dem auch nicht üblen Rest,
die Marylebone Road entlang, Richtung Park.“
2021-01-17
Ein zweiter Band einer Roman-Serie – leider sagt das fast schon alles über dieses Buch. Der erste Band Hologrammatica war
recht aufregend gewesen, er spielte mit dem Cyborg-Thema, ließ Geschlechterwechsel im Minutentakt zu und blieb bis zum Schluss
rätselhaft, unvorhersehbar. Also habe ich es gewagt, auch Band 2 zu lesen. Immerhin macht Hillenbrand nicht den Fehler, einfach
weiterzuerzählen, wo Band 1 aufgehört hat, sondern wechselt die Hauptfigur. Fran – in Band 1 nur eine, wenn auch wichtige
Nebenfigur – wird zur Hauptdarsteller*in (hier macht das Gender-Sternchen 120 Prozent Sinn). Und es braucht eine Weile, bis
man merkt, dass das Buch die vorige Geschichte dann doch weitererzählt. Aber schon der Eröffnungsclou, dass nur seine reflexhafte
Spannerlust dem Opfer eines Anschlags das Leben rettet, weil er seinen Kopf dem „geilen Arsch“ hinterher dreht und so die ihm
zugedachte Kugel sein Gehirn nicht gänzlich zerstört, erweist sich später als Unsinn. Denn die unendlich kluge KI, die die
Killerdrohne steuerte, wollte ohnehin, dass das Opfer überlebt, Ziel des Anschlags war nämlich, sein Gehirn gerade so sehr zu
beschädigen, dass es durch einen Quantencomputer ersetzen werden musste. Der „saftige“ Start – nichts als überflüssige Effekthascherei.
Die ganze Geschichte mit den hochleistungsfähigen Quantencomputern als Gehirnersatz war schon der Clou des ersten Bands, dieser Dreh
machte Körperwechsel erst möglich, Frau wird zu Mann, zu Frau usw. Man darf allerdings nicht darüber nachdenken, dass Computer Strom
brauchen und daher die „Quants“ (Träger eines Gehirnersatzes) eigentlich regelmäßig Akkus aufladen müssten – was im Roman nie
geschieht – aber ich habe in Band 1 gern darüber hinweg gesehen, also tue ich es hier auch. Leider fängt Hillenbrand mit diesen
Körperwechseln nichts mehr an, was wirklich für die Geschichte wesentlich wäre. An einer Stelle gerät Hauptfigur Fran ziemlich
in Stress, weil er/sie unbedingt in ein weibliches Gefäß wechseln muss, um eine bestimmte Person zu etwas zu verführen, was diese
sonst angeblich nicht getan hätte. Nur ist diese Person ebenfalls ein Quant und daher – wie im Roman vorgegeben wird –
„genderfluide“, also gar nicht binär festgelegt. Wozu dieser Körperwechsel gut war, zumal Fran sich am Ende die gewünschte
Kooperation einfach mit einem Haufen Geld erkauft: egal. Genauso überflüssig ein ganzes Kapitel, das davon handelt, dass ein
allmachtsverliebter Tycoon einen japanischen Hacker in den Tod hetzt, weil er bei ihm das Geheimnis des ewigen Lebens erhaschen
will. Dass der Tycoon böse, böse und ganz erzböse ist, hatte man auch schon vorher kapiert. Und besonders überflüssig ist die
Parallelhandlung, die in einem virtuellen Fantasy-Universum spielt. In Band 1 gab es ein ganz ähnliches Muster, aber dort gab
die virtuelle Handlung der heimlichen und eigentlichen Heldin des Romans, Juliette Perrot, den notwendigen Raum, um ihre Geschichte zu entfalten.
Hier ist die virtuelle Fantasyhandlung schon nach wenigen Kapitelhäppchen durchschaubar und für den Plot ohne Belang. Ach ja und
der böse, böse Tycoon entgeht am Ende seiner gerechten Strafe nicht, selbst wenn dabei die Logik arg strapaziert werden muss.
Alles in allem erinnert mich das Buch sehr an die Schwächen von Star Wars Teil 2, weil hier eben nur die Stränge von Teil 1
weitergeführt werden, aber nichts zu Ende erzählt werden darf, da ja noch Teil 3 kommen muss. Hillenbrand beherrscht das
Schreibhandwerk souverän, produziert aber viel Massenware. Mein Fazit: Lest Hologrammatica und lasst diesen seriellen
Aufguss beiseite!
Tom Hillenbrand
Qube
Köln 2020





kann man lesen
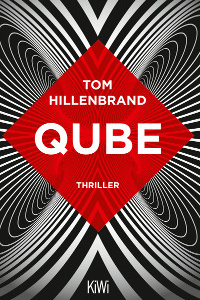
© Kiepenheuer und
Witsch
Paperback (12 €)
545 Seiten
ISBN 978-3-462-05440-8
Der erste Satz (und der zweite)
„Marnie Calvert nahm den Geruch schon im Wagen wahr. Er drang von außen durch die Lüftungsschlitze herein: ein Gemisch aus
verkohltem Holz, oxidiertem Metall und geschmolzenem Kunststoff – Linoleum vielleicht oder Teppichbeschichtung.“
2020-08-10
Dieses Buch habe ich nicht gelesen, sondern mir als Hörbuch vorlesen lassen. Die Hörbuchproduktion ist tadellos, der Vorleser ein
talentierter Profi. Daran lag es also nicht, dass mich das Buch unzufrieden zurück ließ. Der Plot bewegt sich am Rande des eigentlichen
ScienceFiction-Genres – die ganze Geschichte spielt nämlich in der unveränderten Gegenwart des Jahres 2015. Nur wird in dieser Gegenwart
eine Technik entdeckt, die Blicke in die Zukunft erlaubt. Und diese Technik gerät in die Hände einer skrupellosen Geheimorganisation,
deren Wurzeln selbstredend auf die Hitlerzeit zurückreichen. Und ruchlos, wie die Bösen nun einmal sind, manipulieren sie die Zeitlinie so,
dass sie ihre autoritäre Eliteherrschaft im Jahr 2024 errichten können. Der Trick ist, dass sie mit dem Blick in die Zukunft all jene Gegner
identifizieren, die sie 2024 oder davor aufhalten könnten, und sie 2015 einfach ermorden lassen. Tja und das hätte ja alles geklappt,
wenn sie nicht Sam Dryden auf die Füsse getreten hätten. Denn gegen diesen einsamen Helden ist kein Kraut gewachsen. Sam Dryden ist
nämlich ein ex-Elite-Soldat, ein Navy Seal oder ein Was-auch-immer, der es zur Not nur mit einem Bleistift in der Hand mit drei schwer bewaffneten
Profikillern aufnimmt. Und die Bösen machen den Fehler, dass sie Drydens Army-Kameradin Claire entführen. Dryden nimmt den Kampf auf und siehe da:
Er gewinnt. Im Finale erledigt er nicht nur 10 schwer bewaffnete Killer im Alleingang, sondern trickst auch noch einen Kampfhubschrauber
zu Fuß mit dem guten alten „Links blinken und rechts abbiegen“-Trick aus. Das alles nimmt man ja gern hin, ist eigentlich genau wie
damals in den unzähligen Pferdeopern, da erledigten auch die Helden im Alleingang ganze Indianerstämme (sorry, ich meine natürlich lose
Sozialverbände indigener Ureinwohner*innen) und holten mit einem Schuß zwei Stuntmen von den Pferden. Aber hier geht einem das Morden dann doch
irgendwann auf den Wecker. Ich habe nicht genau mit gezählt, aber Dryden bringt es in den drei Tagen, die Handlung umfasst, auf rund 25
Tötungen. Irgendwo mittendrin sagt Dryden zu einem seiner Unterstützer: „Wir sind die Guten!“, nachdem er gerade wieder eine
Reihe von gedungenen Totschlägern erschossen hat. Die größte Schwäche ist aber, dass Lee bei allem Erzähltalent keine wirklichen
Charaktere schildert, sondern stoische Actionfiguren durch die Handlung dirigiert. Und obwohl es in dem Roman auch zwei durchaus
schlagkräftige weibliche Akteurinnen, Claire und Marnie, gibt, sind Frauen
nur dekoratives Beiwerk. Marnie verliebt sich andeutungsweise in Dryden, aber mehr als Beschützen und aus der Klemme raushauen ist
von Drydens Seite nicht drin. Die ganze Geschichte ist sehr spannend, die Leser*in wird vom allwissenden Erzähler meist mit etwas mehr
Informationen gefüttert als der Held selbst und sieht so das Unheil immer schon kommen. Zwei Mal wird man aber auch selbst vom Autor
sehr gekonnt an der Nase herum geführt, das ist gutes Handwerk. Alles in allem trotzdem nur ein mittelmäßiges Buch, die Figuren
bleiben zu eindimensional und lassen einen letztlich kalt.
Patrick Lee
Das Signal
Hamburg 2016





kann man lesen

© Rowohlt Verlag
Paperback (10 €)
464 Seiten
ISBN 978-3-499-27150-2
Der erste Satz (und der zweite)
„Am 7. August 1904 wurde der Schnellzug Nummer 11 der Missouri Pacific Railroad von einer Sturzflut erfasst, als
er gerade auf seinem Weg nach Pueblo, Colorado, eine Bockbrücke überquerte. Eine Wasserwand schwemmte vier der
sechs Waggons fort, und die sterblichen Überreste vornehm gekleideter Männer und Frauen wurden schlammverkrustet
in bis zu fünfundreißig Kilometern Entfernung gefunden.“
2020-05-23
Der Originaltitel: “The Municipalists” ist eigentlich viel treffender, denn Municipalist ist eine*r, die sich um die Belange
des Municipiums – der Stadt, jeder Stadt – kümmert. Der Metropolist hingegen kann nur in der einen Megacity namens Metropolis,
die hier an die Stelle von New York getreten ist, gedeihen und erinnert irgendwie an Polizist. Und ein Polizist ist Henry, der
Held wider Willen dieses erfreulich kurzen Romans, nun ganz bestimmt nicht. Vielmehr ist er das volle Klischee eines freudlosen
Verwaltungshengstes, verknöchert und regelfixiert. Und er kümmert sich um die Belange von Kommunen, erneuert Bahnhöfe, optimiert
Abwasserschächte, allerdings macht er seinen Job in dieser altered reality story in einer Bundesbehörde. Diese Mega-Behörde
namens BKI entscheidet über alles, ob und wo eine Schule, ein Straßenbahnlinie oder was auch immer an Infrastruktur eingerichtet
wird. Eigentlich ist das BKI damit eine Superregierung. Politik gibt es in diesem Szenario nicht wirklich, außer dass es eine
18jährige Bürgermeistertochter gibt, die mit dem Superschurken gemeinsame Sache macht. Dieser Superschurke ist nun vor allem
deshalb ein Schurke, weil er soetwas wie ein Kommunist ist, allerdings die amerikanische Vorstellung von Kommunisten: Er
will doch tatsächlich eine gesicherte wirtschaftliche Existenz für alle Menschen, also auch für die Ärmsten der Armen. Die
Infrastruktur-Behörde BKI hingegen fördert nur dort die Prosperität, wo bereits Geld sitzt. Sie lässt die Armen ungerührt weiter
verarmen, denn wie ein finaler Dialog zwischen dem BKI-Chef und unserem Helden Henry enthüllt, ist die Behörde überzeugt, dass
Hilfen für die Armen nur Schaden anrichten – siehe Gentrifizierung: Stadtentwicklung nutzt nur der Bohème, die Alteingesessenen
aber verlieren ihre Wohnungen. Also besser auch keine Obdachlosenunterkünfte bauen, das schadet den Betroffenen nur. Der „Schurke“ ist
der BKI-Chef von Metropolis und hat erkannt, dass das System nicht zu reformieren ist. Also setzt er auf Terror und formt aus
seinen Mitarbeiter*innen eine fanatische Untergrundarmee, um einen Systemcrash herbeizubomben. Aufhalten können ihn nur Henry
und OWEN. Denn eigentlich ist dieser Roman ein Buddy-Film – ungleiches Paar wächst bei der Rettung der Welt zusammen. OWEN ist die
erste KI, die eine Persönlichkeit entwickelt. Sie tritt via Hologramm in der Geschichte als Akteur auf. Das ist die einzige Stelle,
wo man einiges an suspension of disbelief nötig hat, denn OWEN projeziert sich überall hin über eine Krawattennadel, die Henry
trägt. Und diese hat auch über tausende Kilometer immer eine perfekte Datenverbindung zum Supercomputer und muss in der ganzen
Geschichte nicht einmal aufgeladen werden. Aber egal. Im letzten Viertel erweist sich OWEN als durch einen Virus des Schurken
manipuliert, weshalb der korrekte Henry seinen Kumpel fallen lässt. Erst ganz am Ende erkennt Henry, dass jede Wahrheit, die
sich selbst absolut setzt, zum Terror wird. Einer der wenigen Momente, wo der Roman jenseits von Zynismus Tiefgang entwickelt.
Geschlechterrollen werden in diesem Szenario nicht ernstlich verhandelt, nur die Bürgermeistertochter darf einmal mit ihrer
Gefühlswelt sichtbar werden, aber nur um sich als durch ihre Gefühle fehlgeleitete Terrorbraut zu erweisen. Henrys Persönlichkeit
wird auf ein Kindheitstrauma reduziert, den Verlust beider Eltern bei einem Zugunglück, weshalb er Kontrollfreak mit einem
Eisenbahnfetisch ist. OWEN, durch den Virus unberechenbar gemacht, ist ganz egoistischer Hedonist, der sich selbst spezielle
Programme schreibt, um einen Rausch mit Katerfolgen zu erleben. OWEN säuft sich also durch die Geschichte, die in weiten Teilen
wüste Action mit Explosionen und Kugelhagel ist. Alles in allem kann man das lesen, ohne dass sich einem die Fußnägel ablösen,
aber eine Pageturner ist es nicht, vor allem der klamaukhafte Humor, den der anarchische OWEN produziert, ist bestenfalls lauwarm.
Seth Fried
Der Metropolist
München 2019





kann man lesen
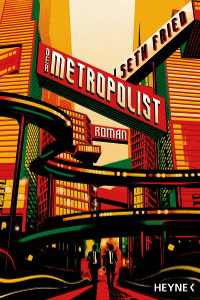
© Heyne Verlag
Paperback (10 €)
317 Seiten
ISBN 978-3-453-32014-7
Der erste Satz (und der zweite)
„Dechert stand am Kraterrand und schaute nach unten. Dionysius war ein Monstrum, drei Kilometer tief und weit genug,
um Manhattan zu schlucken.“
2020-05-10
Routiniert geschriebener Whodunnit-Thriller, der sich unglücklicherweise unter der Hand in einen Militär-SciFi verwandelt.
Einmal mehr rettet ein gebrochener Held die Seinen und nebenbei die Welt. Nur geht es elendig lang um das Kriegstrauma
des Helden. Viel spannender wäre es gewesen, wenn der Autor versucht hätte, die ansatzweise vorhandene Liebesgeschichte
zwischen dem Held und seiner Nummer zwei, der abgebrühten Sicherheitschefin seiner Mondstation, zu entwickeln. Aber
Pedreira erlaubt dem Helden nur Tränen der Erleichterung, als sie final gerettet unter den Überlebenden ist. Sehr
schade, Pedreira hat durchaus lyrische Qualitäten, die er aber leider vor allem zum Ausmalen der inneren Zerfressenheit
und des abgrundtiefen Unglücks in der Seele des Helden nutzt. Als der Plot ungefähr auf der Hälfte der Strecke in die
altbackenen Gleise des Militär-SciFi gleitet, wird es arg schematisch. Schon zuvor war viel Ablästern über die
„Sesselpupser“ – ja, selbst auf dieses alberne Wort konnte nicht verzichtet werden – der Verwaltung dabei. Dann aber
ist es ganz die Heldengeschichte der verratenen Frontschweine, die von unfähigen oder gewissenlosen Vorgesetzten in
den Tod gehetzt werden, sozusagen die dystopische Variante der glorreichen Armee, die gegen alle Widerstände siegt.
Hier schafft es der Held natürlich, die große Verschwörung der Geheimdienste, unfähigen & gewissenlosen Politiker (nein,
in weiblicher Form kommen sie nicht vor) und sonstiger Arschlöcher aufzudecken und einen sinnlosen Krieg zu verhindern.
Anti-Kriegsprosa geht anders. Geschlechterbeziehungen kommen einfach nicht vor – wie gesagt, die Sicherheitschefin als
einzige weibliche Figur bleibt ein unnahbarer Klotz, halt ein echter Mann, nur ohne Schwanz. Männer unter sich, könnte
man sagen. Der Roman liest sich aber trotzdem ganz gut weg, etwas längliche Ausschilderungspassagen kann man gefahrlos
überspringen, sie dienen allein der Colorierung. Es bleibt die meiste Zeit spannend, nur kommt das furiose Finale 20
Seiten vor dem Ende, der Nachklapp soll schön zynisch sein, ist aber eher mager. Fazit: kann man lesen. Wer keinen
Tiefgang verlangt, wird's nicht bereuen.
David Pedreira
Killing Moon
Köln 2018





kann man lesen
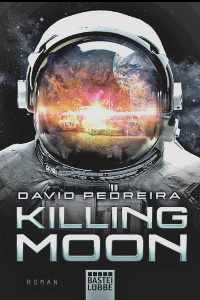
© Bastei Lübbe Verlag
Paperback (10 €)
349 Seiten
ISBN 978-3-404-17696-0
Der erste Satz (und der zweite)
„‚Mom, darf ich mir die Sterne anschauen?‘ Tessa sah von ihrer kleinen Werkbank auf und zu ihrer noch kleineren
Tochter herunter.“
2020-05-01
Kein schlechtes Buch, nur unfassbar langweilig. Nein, „langweilig“ ist das falsche Wort, dafür braucht es ein komplett
antiquiertes Wort wie „betulich“. Chambers war mit dem tollen Titel ihres Erstlings „The Long Way to a Small, Angry Planet“
angenehm aufgefallen, bloß hatte schon dieses vielgepriesene Werk einen Aufregerfaktor dicht bei Null, alles bewegt sich
im Rahmen des absolut Erwartbaren und Erbaulichen. Immerhin gab es bei Small, Angry Planet hin und wieder Aktion.
Bei Unter uns die Nacht passiert ausführlich nichts. Auch das kann ja große Kunst sein. Der Action-Faktor etwa von
Solaris ist ja auch ausgesprochen niedrig und trotzdem erfährt man von ungeahnten Tiefen des Menschlichen. Nicht so
bei Chambers. Ihre Miniaturen
über Tessa, Eyas, Isabel, Kip und Sawyer wollen Entwicklungsstudien besagter Persönlichkeiten sein, was aber allenfalls bei
den ersten beiden in Ansätzen gelingt. Chambers hat erkennbar große Schwierigkeiten empathisch mit männlichen Charakteren
umzugehen, insbesondere die Zeichnung der Figur des Sawyers, der einen ziemlich unglaubwürdigen Tod sterben muss, wirkt wie
eine kalte Stilübung. Man darf auch nicht allzulang über manches technische Detail nachdenken, das für den Plot wohl erforderlich
schien, aber kaum einleuchten will. Gleich zu Anfang wird ein riesiges Weltraumhabitat leck gerissen und dekomprimiert tutto
completto, Menschen sterben zu zehntausenden. Ausgelöst haben soll das alles ein fehlgeleitetes Shuttle, das aufprallte und
die Hülle aufriss. Wie das bei einem in rotierende Segmente aufgeteiltem Schiff passieren kann, das nicht aus einem einzigen
Innenraum besteht, sondern viele wahrscheinlich mit Schotten gegeneinander abgegrenzte Einzelräume besitzt, bleibt unerklärt.
Aber Schwamm drüber – auch die Titanic ist untergegangen, trotz ihrer vielen mit Schotten abgegrenzten Rumpfsektionen. Nur wie
es dann sein kann, dass in diesem total zerstörten Schiff Wohnräume auch nach Jahren noch so luftdicht verriegelt sind, dass
sie Atmosphärendruck enthalten – das nicht zu wissen, wird dem Anfänger Sawyer zum Verhängnis –, da hilft dann auch keine noch
so gutwillige suspension of disbelief. Entweder das Schiff wird mit einem Leck komplett dekomprimiert oder die Wohnräume haben
luftdichte Schotten und können den Schaden solch eines Unglücks eindämmen. Beides zusammen geht nicht. Völlig verzichtbar sind
die Einschübe, die eine Alien-Perspektive auf die Reste der menschlichen Zivilisation der Zukunft bieten sollen. Dieser Part,
der von einer Alien-Ethnologin handelt, die die menschlichen Weltraumhabitate zu Forschungszwecken besucht, ist noch handlungsärmer
und langweiliger als der Rest. Es gibt gleichwohl auch Passagen dichter Schilderung, die mich gerührt haben, wie etwa die Beerdigung
Sawyers, die überzeugend von einem Versuch der Wiederherstellung verloren gegangener Würde, der Sinngebung des Sinnlosen erzählt.
Insgesamt jedoch versagt der Roman bei dem Entwurf einer Gesellschaft, die sich radikal am gesamtgesellschaftlichen Nutzen und
Gebrauchswert orientiert und die Warenform hinter sich gelassen hat. Unter der Messlatte, die Ursula LeGuin mit Planet der
Habenichtse gelegt hat, läuft dieser Roman glatt durch.
Becky Chambers
Unter uns die Nacht
Frankfurt / M. 2019





Kann man lesen, wenn nichts anderes da ist.

© Fischer Verlag
Paperback (9,99 €)
462 Seiten
ISBN 978-3-596-70262-6
Der erste Satz (und der zweite)
„Wenn man lange genug in den Abgrund schaut, wird einen der Abgrund verschlingen. Davon war Coanas Erzeuger immer überzeugt.“
2020-02-29
Ich lese in aller Regel auch schlechte Bücher zu Ende, allein schon, weil ich wissen will, ob ich wirklich die Wendungen des
Plots komplett vorhersagen kann. Dieses Buch nun ist so schlecht, dass ich es nicht fertig gebracht habe, es bis zu Ende
anzuhören. Ja, hören, denn diesen Roman habe ich als Hörbuch auf Spotify entdeckt. (Spotify hat eine sehr beachtliche
Hörbuch-Bibliothek, die allerdings absolut erbärmlich erschlossen ist, aber das ist ein anderes Thema.) Ein männlicher Held
mit Neigung zum Ungehorsam rettet das Universum. Selbiges ist bedroht durch eine Finsternis, die alles verschlingt, was sich
ihr in den Weg stellt. Bald stellt sich heraus, dass es eigentlich nur ein hirnarmer Schwarm überlichtschneller „Fische“ ist,
die dummerweise Sonnen als Hauptspeise verschlingen und Gasplaneten gerne als Dessert. „Die wollen nur spielen.“ Das dumme Militär
wirft sich eifrig in die Schlacht und wird zerschmettert. Da muss der Held ran, der allein die rettende Idee hat. So weit, so MacGyver.
Ich habe eigentlich nichts gegen „schlechte“ Bücher in dem Sinne, dass sie eine banale Standard-Handlung einigermaßen gekonnt erzählen.
Perplies jedoch zeigt schon auf den ersten Seiten, dass ihm jede Idee fehlt, wie eine zukünftige Welt aussehen könnte. Selbst wenn er
fremde Wesen von fernsten Planeten erfindet, spielt ein Lächeln um ihre Mundwinkel, wenn sie erfreut sind. Alles wird ihm zum Mensch
– und zwar zum Mensch des 20. Jahrhunderts. Ein Crewmitglied, das einer nicht menschlichen Spezies („Rhinoa“) entstammt und als eine
schrankgroße weibliche Variante des Hulk geschildert wird, trägt ihr Haar „militärisch kurz“. Ignoriert man einmal kurz die Frage,
warum alle Aliens Haare auf dem Kopf tragen, war kurzes Haar eigentlich nur im 20. Jahrhundert klar mit „Militär“ assoziiert. Weder
Alexander der Große, noch General Custer trugen kurze Haare. Aber Perplies bringt es fertig, selbst eine sechs Meter große Qualle mit
telepathisch begabtem Megahirn in seiner Schilderung zum Mensch zu machen, indem sie bei passender Gelegenheit mit „herrischer Geste“
andere Artgenossen „zum Schweigen“ bringt. Besagte Wesen verständigen sich durch Geisteskommunikation, haben keine Augen, keinen Mund
und keine Arme – aber benutzen „herrische Gesten“. Noch trauriger ist die Schilderung der „Fleuryl“, einer geschlechtslosen pflanzlichen
Spezies, die gern mit Blättern raschelt. Hier wollte sich Perplies durch Verwendung eigens erfundener geschlechtsneutraler Pronomen
(„sieer“ statt „er“ oder „sie“) auf Höhe des Genderdiskurses zeigen. Tatsächlich jedoch wird keine andere Figur so eindeutig „weiblich“
geschildert, wie die Fleuryl-Diplomatenpersona, die in Perplies' Romanwelt die Verkommenheit der Politik darstellen darf. Die ganze
Geschichte wird allein von hölzernen Dialogen vorangetrieben und ist so vorhersehbar, dass man in der Mitte des Buches bereits klar
weiß, was am Ende passiert – genau, die 50 verschütteten Barakkaraner auf dem Erzminenmond müssen noch gerettet werden. Auch das
erledigt der Held zuverlässig. Hätte ich vorher gewusst, dass der Autor auch einige Bücher zum Perry-Rhodan-Universum beigetragen hat,
hätte ich gleich die Finger davon gelassen. Hier vergebe ich erstmalig keinen einzigen Stern.
zurück zu den nächst neueren Einträgen
(2021-04-17 bis 2022-04-05)
weiter zu den ältesten Einträgen
(2019-06-04 bis 2019-08-04)
Bernd Perplies
Am Abgrund der Unendlichkeit
Köln 2019





unterirdisch

© Bastei Lübbe Verlag
Paperback (10 €)
368 Seiten
ISBN 978-3404208753